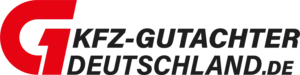Wenn Menschen nach einem Crash darüber nachdenken, eine Eigenreparatur nach Unfall durchzuführen, steckt dahinter selten nur der Wunsch, selbst zu schrauben. Viel öfter geht es um knallharte Realität: Werkstattkosten steigen, Versicherungen sind kompliziert und viele fragen sich, ob sie ihr Auto nach Unfall selbst reparieren können, um Geld zu sparen – gerade im Rahmen der fiktiven Abrechnung. Die Idee klingt erst mal logisch: Schaden kalkulieren lassen, selbst reparieren und das Geld behalten. Aber genau diese Mischung aus Hoffnung, Halbwissen und Zeitdruck führt dazu, dass viele Risiken unterschätzt werden.
Die finanzielle Realität: Wenn das Budget eng wird
Reparaturen sind heute teurer denn je. Die Vorstellung, das Fahrzeug selbst zu reparieren nach Unfall, ist attraktiv, weil man glaubt: „Was der Gutachter ansetzt, kann ich günstiger umsetzen.“ Für manche funktioniert das tatsächlich – aber nur, wenn die Regulierung sauber läuft und die Versicherung später keine Lücken findet, die sie nutzen kann, um zu kürzen.
Der Gedanke „Ich repariere selbst und spare richtig Geld“
Dieser Gedanke ist absolut menschlich. Viele überlegen eine Eigenreparatur Unfall, weil sie das Gefühl haben, die Versicherung trickst sowieso – also repariert man lieber selbst und nimmt die Auszahlung mit. Das Problem: Versicherungen schauen bei Fällen, in denen jemand den Unfall selbst reparieren will, automatisch genauer hin. Ungenaue Dokumentation? Teile ohne Nachweis? Zack, Kürzung.
Warum Versicherungen bei Eigenreparaturen besonders kritisch reagieren
Sobald ein Geschädigter Eigenreparaturen nach Unfall plant, gehen bei Versicherungen die Alarmlichter an. Sie wissen: Hier kann vieles schiefgehen – von fehlenden Belegen bis zu unsauberen Arbeiten. Und wenn die Versicherung Zweifel hat, wird gerne nachgehakt:
- „Wo sind die Fotos?“
- „Welche Teile wurden verwendet?“
- „Ist die Reparatur fachgerecht?“
Ohne saubere Beweise wird aus Geld sparen schnell Geld verlieren. Das heißt nicht, dass man nicht selbst reparieren darf – aber man muss wissen, wie man es richtig macht.
Darf man das überhaupt? Die rechtlichen Grundlagen der Eigenreparatur nach Unfall
Viele Geschädigte sind überrascht, wenn sie hören, dass Eigenreparaturen nach Unfall grundsätzlich erlaubt sind. Das Gesetz schreibt nicht vor, dass eine Werkstatt beauftragt werden muss, und es verlangt auch keine Reparatur nach Herstellervorgaben. Entscheidend ist etwas anderes: Die Regulierung muss nachvollziehbar bleiben. Wer sein Auto nach Unfall selbst reparieren will, muss also nicht um Erlaubnis fragen – er muss lediglich dafür sorgen, dass hinterher niemand infrage stellen kann, was tatsächlich passiert ist. Genau an diesem Punkt trennen sich Theorie und Praxis, denn Versicherungen akzeptieren Eigenreparaturen zwar, doch sie prüfen solche Fälle mit deutlich größerer Skepsis.
Die sogenannte fiktive Abrechnung bildet die Grundlage. Sie ermöglicht es Geschädigten, sich den im Gutachten kalkulierten Reparaturbetrag auszahlen zu lassen, ohne eine Werkstatt zu beauftragen. Viele nutzen diese Option, um später selbst Hand anzulegen oder mit günstigeren Methoden zu arbeiten. Die Logik dahinter ist nachvollziehbar: Wenn das Gutachten einen Betrag X feststellt, warum sollte man diesen nicht nutzen, um den Schaden wirtschaftlich auf eigene Weise zu beheben? Doch hier lauert die eigentlich entscheidende Herausforderung. Die fiktive Abrechnung funktioniert nur so lange reibungslos, wie die Versicherung davon ausgehen kann, dass die kalkulierten Positionen tatsächlich schadensbedingt und notwendig waren. Sobald Zweifel entstehen, beginnt der Streit.
Es muss im Rahmen bleiben
Hinzu kommt, dass rechtlich ein gewisser Rahmen unbedingt eingehalten werden muss. Wer eine Eigenreparatur Unfall durchführt, darf zwar selbst reparieren, doch er übernimmt damit auch die Verantwortung für Qualität und Beweisführung. Gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen wie Fahrwerk, Bremsen oder Lenkung kann eine unsachgemäße Reparatur im schlimmsten Fall juristische Folgen haben, insbesondere wenn später erneut ein Unfall passiert. Für die Versicherung ist das irrelevant für die Auszahlung, aber hochrelevant, sobald eine Werkstatt den Schaden dokumentiert oder ein Gutachter später eine technische Ursache untersuchen muss.
In der Praxis entsteht ein Spannungsfeld: Geschädigte möchten den Unfall selbst reparieren, die Versicherung möchte saubere Nachweise und das Recht verlangt eine lückenlose Herleitung der Schadenshöhe. Wer sich hier sicher bewegen will, braucht ein gültiges Unfallgutachten als Basis. Es ist die einzige objektive Grundlage, die belegt, welche Schäden vorlagen und wie hoch der Anspruch tatsächlich ist. Ohne dieses Fundament steht jede spätere Diskussion unter dem Verdacht der Manipulation – und der Versicherer nutzt diese Lücke.
Kurz gesagt: Eigenreparaturen nach Unfall sind erlaubt, sogar völlig legal und oft wirtschaftlich sinnvoll. Aber sie funktionieren nur dann problemlos, wenn der Geschädigte versteht, dass er die Beweislast trägt. Wer die Sache ohne Planung angeht, läuft Gefahr, dass die Versicherung Kürzungen vornimmt, weil Dokumentation fehlt oder die Reparatur nicht plausibel erscheint. Wer dagegen die rechtlichen Grundlagen kennt und sauber arbeitet, kann selbst reparieren und dennoch seinen vollen Anspruch durchsetzen.
Welche Nachweise erforderlich sind, damit die Versicherung zahlt
Wer sich für Eigenreparaturen nach Unfall entscheidet, merkt schnell, dass nicht das Schrauben das Problem ist, sondern die Dokumentation. In dem Moment, in dem man sein Auto nach Unfall selbst reparieren möchte, verschiebt sich die Beweislast in Richtung Geschädigter. Werkstätten liefern automatisch Rechnungen, Materialnachweise und Arbeitszeiten. Bei einer Eigenreparatur fehlen all diese Ankerpunkte – und genau deshalb fordert die Versicherung später deutlich mehr Klarheit, als vielen bewusst ist. Man muss im Grunde nachweisen können, was repariert wurde, wie es repariert wurde und ob der Schaden tatsächlich der im Gutachten festgestellte ist.
Das Fundament ist immer das Unfallgutachten. Ohne ein vollständiges, neutral erstelltes Gutachten steht jede fiktive Abrechnung auf wackligen Beinen. Es dokumentiert Schadensumfang, Bauteile, Reparaturweg und Kosten. Wer das Gutachten auslässt und sofort anfängt zu schrauben, steht später oft ohne Beweise da. Viele Versicherungen kürzen dann nicht nur Positionen, sondern stellen die gesamte Regulierung infrage. Genau an diesem Punkt scheitern die meisten, die glauben, sie könnten einen Unfall selbst reparieren und „die Versicherung wird das schon bezahlen“.
Eigenreparatur nach Unfall: Beweise erbringen
Doch selbst mit Gutachten reicht es nicht, einfach nur loszulegen. Jede Eigenreparatur Unfall sollte fotografisch begleitet werden. Das heißt nicht, dass man klinisch perfekte Bilder machen muss, aber es müssen nachvollziehbare Schritte erkennbar sein: Wie sah der Schaden vor Beginn aus? Welche Teile wurden ausgebaut? Welche neu eingebaut? Wie sieht das Ergebnis aus? Fotos dienen als Ersatz für Werkstattdokumentation. Fehlen sie, kommt sehr schnell die Frage des Versicherers: „Woher wissen wir, dass diese Position überhaupt angefallen ist?“
Ebenso wichtig sind Teilebelege. Viele, die ihr Auto selbst reparieren nach Unfall, kaufen Teile günstig gebraucht oder greifen zu Nachbauteilen. Das ist grundsätzlich erlaubt, kann aber ohne Kaufnachweis sofort zu Kürzungen führen. Versicherungen argumentieren dann gerne, dass keine schadensbedingte Reparatur stattgefunden habe oder dass unklare Positionen im Gutachten nicht nachvollziehbar seien. Ein einfacher Beleg, selbst von einem privaten Verkäufer, schützt vor einer ganzen Reihe dieser Angriffe.
Ein weiterer Punkt, den viele unterschätzen: die Nachvollziehbarkeit des Arbeitsablaufs. Bei mechanischen oder sicherheitsrelevanten Bauteilen reicht ein „Ich hab das halt eingebaut“ nicht aus, zumindest nicht dann, wenn später jemand Zweifel anmeldet. Eine kurze Notiz über Arbeitsschritte oder Zwischenfotos genügt oft schon, um eine klare Linie herzustellen. Sie hilft auch dann, wenn später ein Gutachter oder eine gegnerische Versicherung vermutet, dass die Reparatur unfachgerecht war. Je klarer die Dokumentation, desto weniger Angriffsfläche.
Versicherungen nutzen bei Eigenreparaturen nach Unfall jede Unschärfe in der Beweisführung. Fehlt etwas, werden Positionen gestrichen. Ist etwas unplausibel, wird nachgefragt. Und wenn man die Nachweise nicht liefern kann, entscheidet die Versicherung im Zweifel gegen den Geschädigten. Genau deshalb ist die Dokumentation am Ende der entscheidende Faktor, nicht die Reparatur selbst. Wer sauber arbeitet, kann problemlos fiktiv abrechnen und selbst reparieren. Wer ohne Plan loslegt, riskiert Verluste, die weit höher sind als jede Ersparnis.
Die größten Risiken bei der Eigenreparatur nach Unfall
Wer über Eigenreparaturen nach Unfall nachdenkt, sieht meistens zuerst die Chance, Geld zu sparen. Was viele jedoch nicht sehen: Die Risiken sind real, und sie beginnen nicht beim Schrauben, sondern in den Bereichen, in denen man als Laie kaum Erfahrung hat. Das größte Problem ist, dass Schäden nach einem Unfall oft komplexer sind, als es auf den ersten Blick scheint. Wer sein Auto nach Unfall selbst reparieren will, übersieht schnell genau die Dinge, die eine Werkstatt oder ein Gutachter sofort erkennen würde. Damit wächst die Gefahr, dass verdeckte Beschädigungen unentdeckt bleiben und später zu teuren Folgeschäden führen.
Ein Klassiker sind Struktur- und Rahmenbereiche. Hier reicht es nicht aus, Teile zu tauschen oder eine Delle auszubügeln. Selbst geringfügige Abweichungen können das Fahrverhalten beeinflussen, was nicht nur den Wert, sondern auch die Sicherheit gefährdet. Bei Bremsen, Achsen und Lenkung gilt das Gleiche. Eine Eigenreparatur Unfall kann fachlich absolut solide sein, aber wenn sicherheitsrelevante Bauteile betroffen sind, reicht ein kleiner Montagefehler aus, um später ernsthafte Probleme auszulösen. Wer sich in solchen Bereichen nicht wirklich auskennt, sollte diese Arbeiten niemals allein schultern.
Ein weiteres Risiko liegt in der späteren Beweisführung. Viele glauben, dass die Versicherung zufrieden ist, solange das Auto optisch wiederhergestellt ist. Das Gegenteil ist der Fall. Wer fiktiv abrechnet und den Unfall selbst reparieren möchte, muss nicht nur nachweisen, dass der Schaden behoben wurde, sondern dass der Schaden überhaupt in dieser Form vorhanden war. Unsachgemäße Reparaturen wirken auf Versicherungen wie ein Einfallstor. Sie argumentieren dann gerne, dass Schäden nicht nachvollziehbar, falsch behoben oder gar nicht richtig dokumentiert wurden. Und sobald ein Zweifel entsteht, beginnt der Kampf um jede einzelne Position des Gutachtens.
Probleme beim Wiederverkauf
Ein unterschätztes Problem ergibt sich beim Wiederverkauf. Eine Reparatur in Eigenregie kann zwar sauber durchgeführt sein, doch Käufer reagieren äußerst sensibel auf alles, was nicht in einer Fachwerkstatt gemacht wurde. Ein Auto, das nach Unfall selbst repariert wurde, verliert oft mehr an Wert, selbst wenn es technisch einwandfrei ist. Das wirkt sich auch auf spätere Gutachten aus, denn Sachverständige können nur bewerten, was sie nachvollziehen können. Wenn Reparaturen ohne fachliche Dokumentation vorliegen, wird jede zukünftige Bewertung erschwert.
Dann gibt es die juristische Ebene. Wenn eine Eigenreparatur nach Unfall unsachgemäß durchgeführt wurde und später ein weiterer Schaden entsteht, kann die Frage des Mitverschuldens aufkommen. Im schlimmsten Fall wird man im Nachhinein dafür verantwortlich gemacht, dass durch die Reparatur ein sicherheitsrelevantes Problem entstanden ist. Es ist ein Szenario, das selten passiert, aber genau deshalb besonders heikel ist: Man rechnet nicht damit, bis es zu spät ist.
Nicht zuletzt spielt die Versicherung eine Rolle. Sie wird immer wieder prüfen, ob die Reparatur plausibel war und ob der Geschädigte wirklich den Anspruch hat, der im Gutachten festgelegt wurde. Wenn die Nachweise fehlen oder Zweifel auftauchen, ist die Kürzung fast vorprogrammiert. Genau hier zeigt sich das zentrale Risiko: Nicht die Reparatur selbst ist gefährlich, sondern die Kombination aus technischen Anforderungen und den juristischen Fallstricken der Regulierung. Wer diese Risiken nicht kennt, spart am Anfang vielleicht ein paar Euro, verliert aber am Ende viel mehr.
Wann ene Eigenreparatur nach Unfall sinnvoll sind – und wann man es lieber lassen sollte
Bei allen Chancen, die Eigenreparaturen nach Unfall bieten, gibt es Situationen, in denen sie logisch sind – und andere, in denen sie schlicht keine gute Idee darstellen. Viele, die ihr Auto nach Unfall selbst reparieren wollen, tun das aus Kostendruck. Das ist verständlich, aber der entscheidende Punkt ist, ob die Reparatur überhaupt geeignet ist, in Eigenregie durchgeführt zu werden. Nicht jeder Schaden ist gleich, und nicht jeder Schaden lässt sich mit ein paar Werkzeugen, YouTube-Videos und gutem Willen beheben, ohne langfristige Nachteile zu riskieren.
Sinnvoll sind Eigenreparaturen immer dann, wenn der Schaden klar erkennbar, strukturell unkritisch und technisch einfach zu beheben ist. Lackschäden, kleine Beulen, getauschte Anbauteile oder kosmetische Reparaturen fallen in diese Kategorie. In solchen Fällen kann eine fiktive Abrechnung sogar ausgesprochen wirtschaftlich sein. Wer die Arbeit sauber dokumentiert, die Teile nachweist und nachvollziehbar handelt, hat oft keine Probleme mit der Versicherung. In solchen Situationen ist der Gedanke „selbst reparieren nach Unfall“ absolut nachvollziehbar und kann eine reale Ersparnis bringen, ohne die Sicherheit des Fahrzeugs zu gefährden.
Ganz anders sieht es aus, wenn der Schaden über die reine Oberfläche hinausgeht. Sobald Teile wie Fahrwerk, Lenkung, Strukturträger, Airbags oder Assistenzsysteme betroffen sind, sollte man die Finger davon lassen. Viele unterschätzen, wie fein abgestimmt moderne Fahrzeuge sind. Eine Eigenreparatur Unfall, die sich an sicherheitsrelevanten Komponenten versucht, kann später nicht nur technisch, sondern auch rechtlich Probleme verursachen. Und was noch schwerer wiegt: Ein späterer Käufer oder Gutachter erkennt sofort, dass hier nicht fachgerecht gearbeitet wurde – der Wertverlust ist oft höher als jede erhoffte Ersparnis.
Nicht sichtbare Schäden
Ebenfalls problematisch wird es bei Schäden, die zwar unscheinbar wirken, aber im Hintergrund große Folgen haben können. Ein schief sitzendes Spaltmaß kann auf eine verzogene Struktur hindeuten. Ein scheinbar harmloser Stoßstangenschaden kann verdeckte Beschädigungen an Sensoren oder Halterungen verbergen. Wer den Unfall selbst reparieren möchte, braucht entweder Erfahrung oder eine sehr klare Einschätzung eines Gutachters. Ohne diese Grundlage bleibt jede Eigenreparatur ein kalkuliertes Risiko, das sich in der Realität selten auszahlt.
Ein weiterer Punkt, bei dem man Eigenreparaturen nach Unfall lieber lassen sollte, ist die Versicherungsstrategie. Manche Versicherer nutzen Eigenreparaturen als Anlass, um Gutachten infrage zu stellen oder Positionen zu kürzen. Das heißt nicht, dass man nicht selbst reparieren darf – aber es bedeutet, dass man vorbereitet sein muss. Wenn man weiß, dass die Versicherung gern nachhakt, sollte man nicht in Bereichen arbeiten, in denen eine spätere Überprüfung gegen einen ausgelegt werden kann. Je komplexer der Schaden, desto größer wird der Druck, alles lückenlos nachzuweisen.
Am Ende läuft es auf einen einfachen Grundsatz hinaus: Eigenreparatur ist dann sinnvoll, wenn man den Schaden wirklich versteht – technisch, wirtschaftlich und versicherungstechnisch. Sie wird gefährlich, wenn man nur repariert, weil man denkt, man könne „ein paar Euro extra behalten“. Die Entscheidung sollte weniger vom Kontostand abhängen als vom tatsächlichen Risiko. Und wer unsicher ist, fährt immer besser damit, die Situation erst neutral prüfen zu lassen. Ein Gutachter kann genau sagen, ob eine Eigenreparatur tragfähig ist oder ob man sich damit unbemerkt ein großes Problem baut.
Praktische Tipps, wenn man wirklich selbst reparieren will
Wer sich trotz aller Risiken für Eigenreparaturen nach Unfall entscheidet, braucht vor allem eines: einen klaren Plan. Viele beginnen direkt mit dem Schrauben, ohne vorher festzulegen, wie sie den Schaden dokumentieren, welche Teile sie verwenden oder wie sie die Arbeit später für die Versicherung nachvollziehbar machen. Doch genau diese Vorbereitung entscheidet darüber, ob die fiktive Abrechnung problemlos funktioniert – oder ob man in endlosen Diskussionen über Belege, Fotos oder Plausibilität landet. Wer sein Auto nach Unfall selbst reparieren möchte, muss deshalb nicht nur handwerklich denken, sondern immer auch regulatorisch.
Der erste praktische Schritt besteht darin, das Fahrzeug vor Beginn der Reparatur vollständig zu dokumentieren. Das klingt banal, doch gerade das wird am häufigsten vergessen. Klare Fotos aus verschiedenen Winkeln, Detailaufnahmen einzelner Schadstellen, sichtbare Vergleichsbilder mit Maßstab – all das schafft die Grundlage, die man später braucht, wenn die Versicherung Nachfragen stellt. Bei einer Eigenreparatur Unfall ist jedes Bild ein Ersatz für ein Werkstattprotokoll. Schlechte Dokumentation führt fast immer zu Kürzungen, gute Dokumentation stärkt den Anspruch.
Genauso wichtig ist die Wahl der Ersatzteile. Wer selbst repariert nach Unfall, greift oft zu Gebrauchtteilen, weil sie günstig sind. Das ist erlaubt, aber nicht ohne Fallstricke. Man muss nachweisen können, dass diese Teile tatsächlich eingebaut wurden, und dass sie in Art und Funktion den im Gutachten kalkulierten Positionen entsprechen. Die Versicherung prüft genau, ob die Reparatur plausibel war. Wenn Teile ohne Nachweise auftauchen oder wenn eine Rechnung fehlt, wird sofort gefragt, ob überhaupt repariert wurde. Ein einfacher Beleg, selbst handschriftlich vom Verkäufer, verhindert viele dieser Kürzungen.
Tricks der Versicherung
Auch der Arbeitsablauf sollte nachvollziehbar bleiben. Niemand verlangt ein Werkstatthandbuch, aber Zwischenfotos während des Aus- und Einbaus beweisen, dass die Reparatur tatsächlich stattgefunden hat. Gerade wer einen Unfall selbst reparieren möchte, unterschätzt, wie wertvoll diese kleinen Details am Ende sind. Ohne sie wirkt die Reparatur oft wie ein pauschales Behaupten, und das eröffnet der Versicherung ein riesiges Einfallstor. Ein paar Bilder und kurze Notizen machen den Unterschied zwischen „ausreichend dokumentiert“ und „nicht regulierungsfähig“.
Nach Abschluss der Reparatur lohnt sich eine Nachkontrolle – idealerweise durch jemand mit fachlichem Blick. Das muss keine Werkstatt sein, auch wenn das natürlich am sichersten ist. Manchmal reicht ein erfahrener Schrauber, der den Wagen einmal durchgeht, um sicherzustellen, dass keine offensichtlichen Fehler oder Sicherheitsrisiken entstanden sind. Wer sein Auto nach Unfall selbst reparieren will, tut sich damit nicht nur technisch einen Gefallen, sondern schafft auch im Streitfall eine zusätzliche Ebene der Absicherung. Es zeigt, dass die Reparatur nicht improvisiert, sondern bewusst durchgeführt wurde.
Am Ende gilt: Eigenreparaturen nach Unfall funktionieren nur dann wirklich gut, wenn man die Mischung aus handwerklicher Arbeit und juristischer Nachvollziehbarkeit versteht. Es ist kein Hexenwerk, aber es erfordert Disziplin. Wer sauber dokumentiert, Ersatzteile nachweist und den Schaden von Anfang bis Ende plausibel hält, kann ohne Probleme fiktiv abrechnen und selbst reparieren. Wer dagegen nur darauf setzt, „dass die Versicherung schon zahlt“, bekommt früher oder später Ärger. Eigenreparatur ist kein Shortcut – sie ist ein anderer Weg zum gleichen Ziel, und der lässt sich nur beschreiten, wenn man weiß, wie man ihn geht.
FAQ: Eigenreparatur nach Unfall
- Bekomme ich Geld von der Versicherung, auch wenn ich selbst repariere?
Ja, die fiktive Abrechnung ermöglicht genau das. Wenn ein Gutachten vorliegt, zahlt die Versicherung den kalkulierten Betrag aus, unabhängig davon, ob du eine Werkstatt beauftragst oder Eigenreparaturen nach Unfall selbst durchführst. Entscheidend ist, dass der Schaden nachvollziehbar ist und keine Zweifel an den Schadenspositionen bestehen. Wer sein Auto nach Unfall selbst reparieren will, muss daher unbedingt sauber dokumentieren, sonst nutzt die Versicherung jede Lücke, um zu kürzen. - Darf ich Gebrauchtteile verwenden, wenn ich selbst repariere?
Ja, das ist grundsätzlich erlaubt. Bei einer Eigenreparatur Unfall kannst du neue, gebrauchte oder nachgefertigte Teile verwenden. Wichtig ist nur, dass du nachweist, dass diese Teile tatsächlich eingebaut wurden. Ohne Beleg entstehen schnell Zweifel, und die Versicherung kann argumentieren, dass die Reparatur überhaupt nicht stattgefunden hat oder nicht schadensbedingt war. Wer selbst reparieren nach Unfall möchte, sollte jeden Kauf dokumentieren – auch private Verkäufe. - Was passiert, wenn die Versicherung Zweifel an meiner Eigenreparatur hat?
Dann wird nachgehakt. Wenn du dein Auto nach Unfall selbst reparierst und die Versicherung Lücken in der Dokumentation sieht, kann sie Positionen streichen oder Nachweise verlangen. Typisch sind Nachfragen nach Fotos, Teilen oder Arbeitsschritten. Fehlen diese Informationen, kann die Regulierung ins Stocken geraten. Wer Eigenreparaturen nach Unfall ernsthaft plant, sollte das Thema Beweisführung nicht unterschätzen. - Kann ich trotz Eigenreparatur eine Wertminderung bekommen?
Ja, und das ist ein Punkt, den viele falsch einschätzen. Eine Wertminderung hängt vom Schaden ab, nicht von der Frage, wer repariert hat. Selbst wenn du den Unfall selbst reparieren willst, bleibt die Wertminderung bestehen, sofern das Fahrzeug durch den Unfall objektiv an Marktwert verloren hat. Ein Gutachter ermittelt sie unabhängig von der Reparaturart. Das bedeutet: Auch bei einer Eigenreparatur Unfall kann die Wertminderung ein legitimer Anspruch sein. - Was ist, wenn nach der Eigenreparatur später Probleme auftreten?
Dann hängt es davon ab, ob die Probleme aufgrund des ursprünglichen Unfalls oder wegen der Reparatur entstanden sind. Wer Eigenreparaturen nach Unfall unsachgemäß durchführt, kann bei späteren Schäden theoretisch in die Mitverantwortung geraten, besonders wenn sicherheitsrelevante Bereiche betroffen sind. Das ist selten, aber nicht ausgeschlossen. Ein sauberer Arbeitsablauf, gute Dokumentation und eine Nachkontrolle reduzieren dieses Risiko erheblich.